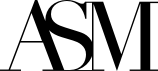Was ist Ihre früheste Erinnerung an Mozart?
ANNE-SOPHIE MUTTER: Mit sechs Jahren hörte ich eine Aufnahme von Clara Haskil. Ich fand immer, dass sie von allen Interpreten den besten Mozart-Stil hatte – der leichte Anschlag, die feinsinnige Phrasierung, der natürliche Fluss –, ohne je zu romantisch zu werden. Die Schönheit ihres Klangs erschien mir als das, was Mozart selbst gesucht hatte und was er in den Briefen an seinen Vater immer erwähnte, wenn er einen Musiker gefunden hatte, der tiefe Emotion durch schönen, differenzierten Klang ausdrücken konnte.
Gab es auch Geiger, deren Mozart–Stil Sie beeindruckte?
ASM: Es gab ein paar wundervolle, frühe Aufnahmen von Isaac Stern und auch von Arthur Grumiaux – aber danach habe ich eigentlich keine Streicher mehr gehört, die Mozart so spielten, wie ich es mir vorstellte.
Was fehlte?
ASM: Man legt heute zuviel Gewicht auf Virtuosität; es fehlen Eleganz, Klarheit und Zurückhaltung – mit Recht nannte Tschaikowsky Mozarts Musik »engelhaft«. Mozarts Musik ist wie eine Röntgenaufnahme unserer Seele, sie zeigt, was dort ist und nicht dort ist. Aber Mozart wird von der jüngeren Generation nicht besonders ernst genommen. Man betrachtet seine Musik abwertend als ziemlich einfach – die Leute wollen mehr Bravour. Entscheidend ist jedoch nicht die Anzahl der Töne, sondern die Interaktion der Instrumente, die Entwicklung der Ideen. Deshalb ist es für einen Interpreten so wichtig, einen ganzen Werkzyklus zu spielen, etwa sämtliche Sonaten von Beethoven oder Mozart, um zu sehen, wie ihre Anfänge beschaffen sind und wohin sie führen, d. h. in diesem Fall zur völlig gleichberechtigten Partnerschaft von Klavier und Geige.
Daher Ihr Projekt?
ASM: Mein Mozart–Projekt beginnt eigentlich nicht erst jetzt. Es fing sehr bescheiden an, als ich mit neun Jahren bei meinem ersten Auftritt das Zweite Violinkonzert mit einem Provinzorchester spielte. Spektakulärer war das Debüt, das ich als Dreizehnjährige mit Herbert von Karajan in Salzburg gab, wo ich das wundervolle G–dur–Konzert aufführte. Seither gehört Mozart einfach zu meinem täglichen Leben. Sein Geist ist immer präsent, selbst wenn ich zeitgenössische Werke spiele, und ich habe ständig neue Versuche unternommen, ihm näher zu kommen. Er ist der Komponist, mit dem ich aufgewachsen bin, der immer auf mich gewartet hat, an jedem Punkt meiner Laufbahn.
Sie haben einige der Stücke schon einmal aufgenommen. Was bedeutet es für Sie, diese Werke erneut einzuspielen?
ASM: Nach 20 oder 30 Jahren glaubt man allmählich, ein Stück zu kennen, sogar wenn es sich um ein Werk von Mozart handelt. Aber ich habe mich immer gegen dieses Gefühl gewehrt. Mir hat es immer Freude bereitet, etwas Neues in einem Werk zu entdecken, selbst wenn es nur eine Passage in der zweiten Geige ist, deren Bedeutung ich vorher nicht erkannt hatte. Und außerdem habe ich in den letzten 30 Jahren viel erlebt – allein das ist Grund genug, einen neuen Anlauf zu nehmen. T. S. Eliot sprach davon, dass man einen Ort nach einer Lebensstrecke zum ersten Mal entdecken könne, obwohl man schon einmal dort gewesen sei. Ich denke auch an den österreichischen Maler Arnulf Rainer, der erklärt, dass sich hinter jedem seiner Bilder noch ein anderes Bild verberge. Selbst wenn die Betrachter das Bild unter der obersten Schicht nicht richtig sehen können, wisse er doch, dass es dort sei. Ähnliches gilt auch für den Interpreten in der Musik. Mit zwölf Jahren bringt man alles rein instinktiv hervor, aber es genügt nicht, sich immer nur vom Instinkt leiten zu lassen – dann wiederholt man sich nur. Man kann nur künstlerisch wachsen, wenn der Instinkt mit einem neugierigen Verstand gepaart ist.
Wie hat sich dieses Aufnahmeprojekt entwickelt?
ASM: Ich hatte die Idee vor sechs Jahren, als sich die Möglichkeit abzeichnete, die Konzerte ohne Dirigenten zu spielen. Ich spürte plötzlich den dringenden Wunsch, es »dieses Mal richtig zu machen«! Ich will aber keineswegs behaupten, dass meine Auffassung von Mozart die letztgültige ist. Mozart braucht meine Unterstützung nicht – er wird noch leben, wenn ich längst vergessen bin. Ich habe mich für das Projekt entschieden, weil ich diese Musik so sehr liebe, weil sie mir Schauer über den Rücken jagt und mich zu Tränen rührt und weil sie die Zuhörer berührt. Das Projekt soll Mozart feiern, es ist eine tiefe Verbeugung vor seinem Genie. Ich hoffe, es gibt für die Zuhörer ein paar positive Neuentdeckungen, aber diese Aufnahmen sollen die bereits vorhandenen nicht ersetzen.
Wie fühlen Sie sich, wenn Sie – de facto – dirigieren?
ASM: Ich bin nicht Dirigentin. Aber ich kann führen – zum einen, weil es in meiner Natur liegt, und zum anderen, weil ich genau weiß, was ich von einem Werk erwarte, und ich es einem Orchester erklären und die Musiker inspirieren kann. Mozart war auch mehr Instrumentalist als Dirigent, und in bescheidenerem Rahmen versuche ich, ihm nachzueifern, indem ich mit einem erweiterten Kammerensemble arbeite, das eine gemeinsame Vorstellung vereint und inspiriert. Inspiration ist der Schlüssel – zu bewirken, dass die Menschen meiner Vorstellung folgen wollen, und Teil jenes nach schöpferischen Prozesses zu sein, der so aufregend ist, wenn daraus ein völlig spontaner Dialog entsteht. Proben sind wichtig, aber es ist sinnlos, morgens ein Pianissimo in Takt 29 anzusagen, wenn man weiß, dass man das Stück abends ganz neu erleben wird. Ohne Dirigenten müssen die Musiker schnell aufeinander reagieren und es geht zwangsläufig spontaner zu.
Wie haben Sie dieses neue Vorhaben begonnen?
ASM: Meinen ersten Vorstoß machte ich mit der Salzburger Camerata. Dann dachte ich, warum nicht mit den Wiener Philharmonikern? – Bei ihnen habe ich viel über die Werke gelernt, denn die Spieler brachten ein paar großartige Ideen ein. Wir hatten viele Diskussionen, und meine Vorstellungen stießen zunächst auf einen gewissen Wider stand, aber ich glaube, ich konnte sie überzeugen. Das London Philharmonic Orchestra, mit dem ich die Konzerte aufgenommen habe, ist eines der wenigen europäischen Orchester, das jedes Jahr Mozart–Opern aufführt. Manche Orchester klingen samtig, aber das LPO ist eher wie ein Porsche – dynamisch und jugendlich (obwohl ich dieses Wort eigentlich nicht gern verwende) –, ihm gelingt einfach alles. Es steht immer unter Hochspannung – sein Mozart ist schnell, nicht was die Tempi angeht, sondern der Reaktionszeit nach. Es ist Kammermusik, ohne es sich je bequem zu machen. Kammermusik ist manchmal zu gemütlich und lau – man spielt für sich selbst, dann trinkt man seinen Tee, man könnte genau so gut zu Hause sein; das Publikum im Saal kümmert einen nicht weiter. Die Nerven sind nicht angespannt. Mit dem LPO spiele ich nicht als Solistin, sondern als Ensemblemitglied im Sinne des Primus inter pares.
Welche technischen Herausforderungen bietet Mozart Ihnen als Geigerin?
ASM: Es geht um weitaus mehr als nur um schönes Spiel. Die Phrasierung spielt eine große Rolle, denn bei Mozart hat man oft Sechzehntel, von denen jeweils zwei legato und zwei spiccato, d. h. deutlich getrennt sind. Dann gilt es beim Staccato–Spiel zwischen Punkten und Strichen in den Vortragsangaben zu unter scheiden. Ich sehe heute, wie die Schüler meiner Stiftung mit diesen Problemen der Bogenführung kämpfen, aber das ist eine unerlässliche Technik, wenn man Mozart spielt: Man muss den Raum zwischen den einzelnen Tönen beachten. Wenn ein Sechzehntel–Lauf nicht ganz gleichmäßig ist, klingt er wie eine Übung oder einfach unelegant. Die richtigen Tonzwischenräume zu finden, gehört zur Kunst des Mozart–Spiels. Ein weiteres Element dieser Kunst ist die Verfeinerung des Klangs, besonders in den tänzerischen Sätzen, den Rondeaux, die ihn in Paris inspirierten. Auch das ist nicht leicht. Bei Mozart ist jede Note kostbar und verdient Beachtung – besonders da die Orchestrierung, die zugleich alles und nichts ist, den Solisten so furchtbar bloßstellt. Es gibt nicht jene unglaubliche Anzahl von Tönen, die in den romantischen Werken einen verführerischen Hintergrund schaffen. Bei Mozart muss jedes Instrument im richtigen Augenblick präsent sein, und zwar angemessen in Stil, Form und Tempo – das verlangt meisterhaftes Spiel von allen Beteiligten. Vielleicht hat mich diese Furcht einflößende Erkenntnis davon abgehalten, Mozart schon früher noch einmal aufzunehmen. Es ist wirklich eine Aufgabe, die man nicht im Handumdrehen erledigt.
Wie ist Ihre Position in der Diskussion um authentische Aufführungen?
ASM: Die so genannten »authentischen« Aufführungen sind für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben einfach andere Hörgewohnheiten als Mozarts Zeitgenossen und leben nicht in einem Vakuum. Ich kann nicht so tun, als könnten wir die Zeit zurückdrehen und wieder so hören wie die Menschen vor 250 Jahren. Wir haben andere Schönheits– und Stilideale: Ich verwende keine Darmsaiten. Ich bin absolut für die moderne Besaitung der Geige, denn das Instrument erhält damit ein größeres Spektrum im Hinblick auf das Volumen und auf Klangfarben und Schattierung. Diese Ausdrucksfähigkeit gehört zu Mozarts Kompositionsstil. Die Form des Geigenbogens wurde nicht ohne Grund um 1755 weiterentwickelt. Man war auf der Suche nach mehr Ausdruck und Flexibilität.
Wenn er heute lebte, wäre er also kein Vertreter der historischen Aufführungspraxis?
ASM: Er würde wohl gelegentlich das vibratofreie Spiel dem durchwegs satten Klang vorziehen. Ein größeres Orchester hätte ihn begeistert, die Größe seiner Orchester richtete sich immer nach dem Verfügbaren. Die Besetzung meines Orchesters ist 8–8–6–4–1, was für die damalige Zeit relativ groß ist und hoffentlich wundervoll klingt! Aber, wenn erforderlich, ist der Klang transparent und kammermusikalisch. Wir haben z. B. einige der Rondeau–Menuettsätze und das Adagio des KV 219 nur in Quartettbesetzung aufgenommen. Man muss auch bedenken, dass ein sehr kleines Ensemble in einem sehr großen Saal zu schwach und kraftlos wirken kann; ein Grund, warum wir größere Orchester brauchen. Selten sind Streicher in der Lage, ein Pianissimo zu spielen, das wirklich trägt – ihre Pianissimi ersterben meist schon in der ersten Reihe. Ein Pianissimo muss sich ausbreiten, es muss von innen leuchten und darf nicht wie eine graue Maus klingen.
Wie bedeutsam ist die Wahl der Tempi?
ASM: Absolut entscheidend. Allerdings gibt es zwar falsche Tempi, aber nie eines, das verbindlich richtig ist. Tempi beruhen auf der Beziehung der Sätze zueinander, und darin sehe ich eine feste Größe. Wenn ich ein Allegro beginne, muss ich wissen, in welcher Beziehung das Andante und das Presto dazu stehen werden. Wie schnell das Allegro dann tatsächlich ist, hängt von der Größe des Saals ab, von der Akustik oder, wenn es um eine Sonate geht, von der Mechanik des Klaviers und seiner Repetitionsfähigkeit. In einigen späten Mozart–Sonaten verlangen die schnellen Sätze rasche Tonwiederholungen, und die damaligen Instrumente boten dazu bessere Möglichkeiten als unsere modernen und hatten zudem viel weniger Resonanz. Das sind Aspekte von Mozarts Musik, die wir neu umsetzen müssen. Man spielte also auch einen langsamen Satz in zügigerem Tempo, weil der Klang sonst zu dünn und kaum noch hörbar würde. Auf einem modernen Klavier und in einem großen Saal muss das Instrument atmen und die Töne aussingen, weil sie sonst überlappen. Ähnliches gilt für die Finalsätze, die wir leider nicht so schnell spielen können, wie es auf einem Instrument aus Mozarts Zeit möglich gewesen wäre. Die Repetitionsmechanik ist langsamer, der Ton klingt länger – dadurch benötigt die Musik mehr Raum. Lambert Orkis wird natürlich versuchen, die meisten Sonaten ohne Pedal zu spielen, um den Klang so trocken und transparent wie möglich zu machen. Wir werden den Klangfarben, die man zu Mozarts Zeiten gehört hätte, so nahe kommen, wie wir irgend können. All diese Überlegungen verhindern, dass die Tempi wie in Stein gemeißelt sind.
Wie schätzen Sie die Konzerte ein, die ja alle Frühwerke sind?
ASM: Mozart selbst spielte sie alle mit ungeheurem Erfolg, besonders das erste, das noch dem virtuosen italienischen Stil verpflichtet ist, bei dem das Orchester bescheiden im Hintergrund bleibt, während die Geige ihre akrobatischen Kunststücke vollführt. Das zweite Konzert ist viel eleganter und zeigt französischen Einfluss, auch im abschließenden Rondeau, aber diese ersten beiden Konzerte sind gegenüber den letzten drei in jeder Hinsicht konventioneller. Mit Recht nennt Alfred Einstein das Adagio von KV 216 »wie vom Himmel gefallen« – der Klang gedämpfter Streicher war etwas Neuartiges und taucht den ganzen Satz in ein magisches Licht, und das Rondeau ist viel kühner als die früheren. Vor allem aber gibt es jetzt einen gleichberechtigten Dialog von Geige und Orchester, während das Orchester in den beiden ersten Konzerten nur ein Partner im Hintergrund war. Hier hat Mozart die Idealgestalt des Violinkonzerts gefunden.
Viele Geiger fürchten den Beginn des Konzerts KV 218. Geht es Ihnen auch so?
ASM: Er gilt als sehr schwierig, aber ich habe das nie so empfunden. Es ist eine kleine Fanfare hoch oben auf der E–Saite, und manche meiner Kollegen sind nicht gern dort oben. Es ist wie mit der Koloraturarie in der Zauberflöte: Entweder man trifft die hohen Töne oder nicht – und jeder merkt es, wenn letzteres passiert. Aber KV 218 ist auch in anderer Hinsicht ein interessantes Werk, in dem die Tutti etwas von einem symphonischen Drama haben, viel stärker ausgearbeitet und entwickelt als früher. Das Andante wird von den wunderbar kantablen Oboen eingeleitet, das Rondeau überrascht mit seinen Rhythmus– und Stimmungswechseln.
Krönen der Höhepunkt ist allerdings KV 219, denn hier experimentiert Mozart mit zahlreichen neuen Ideen. Es ist das kühnste, vielschichtigste Konzert, voller abrupter Stimmungswechsel. Der erste Einsatz des Solisten erfolgt ganz ungewöhnlich nicht mit dem Hauptthema des Allegro, sondern mit einer Adagio–Introduktion, die eine wunderschöne neue musikalische Idee entfaltet. Nach dem lyrischen zweiten Satz, einem groß angelegten Adagio, endet das Finale schließlich in einem bezaubernden Menuett. Es wird jedoch von einer wild–dämonischen »alla turca«–Episode unterbrochen, die allerdings eher ungarischen als türkischen Charakter hat. Zu Mozarts Zeit verwendeten die Österreicher diesen Begriff gern für jedes musikalische Idiom aus dem Osten.
Wie sehen Sie die Sinfonia concertante?
ASM: Mozart komponierte das Werk 1779 nach seiner Rückkehr nach Salzburg. Er war mit der Gattung in Paris und Mannheim vertraut geworden, wo sie sehr in Mode war. Der Titel rührt daher, dass es sich tatsächlich um eine Symphonie mit zwei Solisten handelt, die als gleich berechtigte Partner des Orchesters behandelt werden. Die Sinfonia concertante ist offensichtlich mit Blick auf die hervorragenden Musiker geschrieben worden, die in Salzburg zur Verfügung standen. Es ist ein dunkel gefärbtes, dramatisches Werk mit sehr gegensätzlichen Stimmungen und einem subtilen, wohlüberlegten Gleichgewicht zwischen den Solo– und Tuttipassagen. Interessant ist auch die Teilung der Bratschensektion. Das Andante in c–moll ist wohl einer der ergreifendsten langsamen Sätze der Musikgeschichte. Das ganze Werk ist durch eine Überfülle von Ideen gekennzeichnet und ein wunderbares Beispiel für die neue Musiksprache, die Mozart zu jener Zeit entwickelte.
Ihr Partner in der Sinfonia concertante ist Yuri Bashmet ...
ASM: Ich halte ihn für den größten Bratschisten. Er arbeitet seit 30 Jahren daran, das Repertoire seines Instruments zu vergrößern, und künftige Bratschisten werden zahl reiche Werke spielen können, die er angeregt hat. Ich mag seine ungeheure Emotionalität, die man vielleicht nicht bei einem Mozart–Interpreten erwartet, die ihn aber manch mal zu Einfällen veranlasst, auf die ich nie gekommen wäre. Ich arbeite gern mit Menschen zusammen, die zwar einen ähnlichen Ansatz haben wie ich selbst, aber ganz andere Ideen einbringen, so dass wir zusammenwachsen wie Yin und Yang.
Von wem sind Ihre Kadenzen?
ASM: Von verschiedenen wunderbaren Geigern, aber einige kleinere habe ich selbst zusammengestellt, ein bisschen von mir und ein bisschen von Monsieur X. Mozart hat leider seine eigenen Kadenzen nicht schriftlich festgehalten, wie er es für manche Klavierkonzerte tat.
Wie sollte eine gute Kadenz beschaffen sein?
ASM: Sie sollte auf Themenmaterial zurückgreifen, aber improvisiert klingen. Da moderne Solisten wie ich selbst keine Improvisatoren sind, brauchen wir leider ausgeschriebene Kadenzen. Eine Kadenz sollte im stilistischen Rahmen des Werks bleiben, sie sollte wie eine Zusammenfassung sein, ein Epilog, aber mit einem kleinen Aufblitzen von »Hoppla! – hier ist noch ein neuer Gedanke«.
Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie die Trios ausgewählt, die Sie mit Sir André Previn und Daniel Müller–Schott spielen?
ASM: Ehrlich gesagt, habe ich die genommen, in denen die Geige am meisten zu sagen hat! Aber es sind herrliche Stücke, deren Form auf Haydn zurückgeht, mit der traditionellen Verdopplungsstruktur in den frühen Trios, Geigen– und Cellopart spiegeln sich in der rechten bzw. linken Hand des Pianisten und entwickeln sich zu gleichberechtigten Partnern. Hier komponierte Mozart im besten Sinne des Wortes zum reinen auch eigenen Vergnügen. Einige der Klavier–Trios spielte er oft selbst.
Wie eng beziehen Sie die Werke auf Mozarts Lebenssituation?
ASM: Wir sind heutzutage zu versessen darauf, uns in das Privatleben der Komponisten zu vertiefen. Für uns ist die Musik bestimmt, alles andere ist privat. Aber einige Sonaten lassen sich mit Ereignissen in Mozarts Leben in Verbindung bringen. KV 304 ist ein Echo auf den Tod seiner Mutter, doch wir sollten nicht vergessen, dass er zur selben Zeit auch die extrovertierte »Pariser Symphonie« und die ebenso extrovertierte D–dur–Sonate aus derselben Werkgruppe schrieb. Wichtig erscheint mir jedoch, was er während der Entstehungszeit der Violinwerke sonst noch schrieb. Als er seine sehr kühne Sonate KV 526 schuf, arbeitete Mozart auch an Don Giovanni und an der »Jupiter–Symphonie«.
Bei diesem Projekt arbeiten Sie offenbar mit einem neuen Fotografen zusammen.
ASM: Ich habe immer nach einem fotografischen Vokabular gesucht, das mein Gefühl für Musik in Bilder übersetzen kann. Ich habe bisher mit sehr guten Fotografen gearbeitet, aber für dieses Projekt brauchte ich eine neue Bildsprache, neue Ausdrucksmöglichkeiten, vor allem weil es um so vielschichtige Musik geht. Tina Tahir scheint in ihrem visuellen Vokabular die richtige poetische Kraft zu besitzen, um meine Vorstellungen wiederzugeben.
August 2005