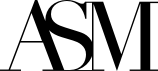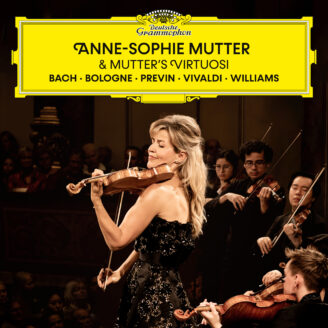Einige der Werke, die zu diesem Projekt gehören, hat sie schon einmal aufgenommen. Doch nicht nur sie selbst, auch ihre Mozart-Auffassung hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. »Mit zwölf Jahren bringt man alles rein instinktiv hervor«, sagt sie, »aber es genügt nicht, sich immer nur vom Instinkt leiten zu lassen – dann wiederholt man sich. Man kann nur künstlerisch wachsen, wenn der Instinkt mit einem neugierigen Verstand gepaart ist.« In keiner Weise soll das Projekt einen Schlusspunkt setzen: »Ich hoffe, es gibt für die Zuhörer ein paar positive Überraschungen, aber diese Aufnahmen sollen die bereits vorhandenen nicht ersetzen. Das Projekt soll Mozart feiern und ist eine tiefe Verbeugung vor seinem Genie.«
Ebenso wenig will sich die Geigerin die Rolle der Dirigentin anmaßen. »Ich bin nicht Dirigentin. Aber ich kann führen – zum einen, weil es in meiner Natur liegt, und zum anderen, weil ich genau weiß, was ich von einem Werk erwarte, und ich es einem Orchester erklären und die Musiker inspirieren kann. Mozart war auch mehr Instrumentalist als Dirigent, und in bescheidenerem Rahmen versuche ich, ihm nachzueifern.« Sie hat die Konzerte zwar schon ohne Dirigenten mit den Wiener Philharmonikern gespielt, es liegt ihr jedoch besonders am Herzen, die Aufnahmen mit dem London Philharmonic Orchestra zu machen: »Manche Orchester klingen samtig, aber das LPO ist eher wie ein Porsche – dynamisch und jugendlich, ihm gelingt einfach alles. Sein Mozart ist schnell, nicht was die Tempi angeht, sondern der Reaktionszeit nach. Es ist Kammermusik, ohne es sich je bequem zu machen.
Mozart, sagt sie, verlangt weitaus mehr als »schönes« Spiel. Bogenführung und der Raum zwischen den Tönen spielen eine besondere Rolle. »Bei Mozart ist jede Note kostbar und verdient Beachtung – besonders da die Orchestrierung den Solisten so furchtbar bloßstellt. In den romantischen Werken schafft die Orchestrierung einen verführerischen Hintergrund für den Geiger. Aber bei Mozart muss jedes Instrument im richtigen Augenblick präsent sein, und zwar angemessen in Stil, Form und Tempo – das verlangt meisterhaftes Spiel von allen Beteiligten. Vielleicht hat mich diese Furcht einflößende Erkenntnis davon abgehalten, Mozart schon früher noch einmal aufzunehmen.« Im Übrigen hält sie nicht viel von der Art, wie Mozart meist gespielt wird: »Man legt heute zu viel Gewicht auf Virtuosität, es fehlen Eleganz, Klarheit und Zurückhaltung – mit Recht nannte Tschaikowsky Mozarts Musik ›engelhaft‹. Mozarts Musik ist wie eine Röntgenaufnahme unserer Seele, sie zeigt, was dort ist und nicht dort ist.«
Mit Bedacht distanziert Anne-Sophie Mutter sich von jeder Vorstellung einer historisch »authentischen« Aufführung, die ihr als Ding der Unmöglichkeit erscheint. »Wir haben einfach andere Hörgewohnheiten als Mozarts Zeitgenossen und leben nicht in einem Vakuum. Ich kann nicht so tun, als könnten wir die Zeit zurückdrehen und wieder so hören wie die Menschen vor 250 Jahren. Wir haben andere Schönheits- und Stilideale.« Sie verwendet keine Darmsaiten, sondern ist absolut für die moderne Besaitung der Geige, weil das Instrument damit größere Möglichkeiten im Hinblick auf das Volumen und auf Klangfarben und Schattierung erhalte. »Diese Ausdrucksfähigkeit gehört zu Mozarts Kompositionsstil.«
Offen gibt sie zu, diejenigen Trios für die Aufnahme ausgewählt zu haben, in denen die Geige am meisten zu sagen hat. Diese Werke habe Mozart zum reinen Vergnügen geschrieben, auch zu seinem eigenen, denn er spielte sie ziemlich häufig. Die Konzerte zeigen ihrer Ansicht nach ein erstaunlich rasches Aufblühen von Mozarts Genie innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne. In den Sonaten habe er allmählich die Geige aus der untergeordneten Rolle befreit, die sie im 18. Jahrhundert als Begleitinstrument hatte.