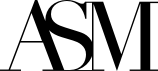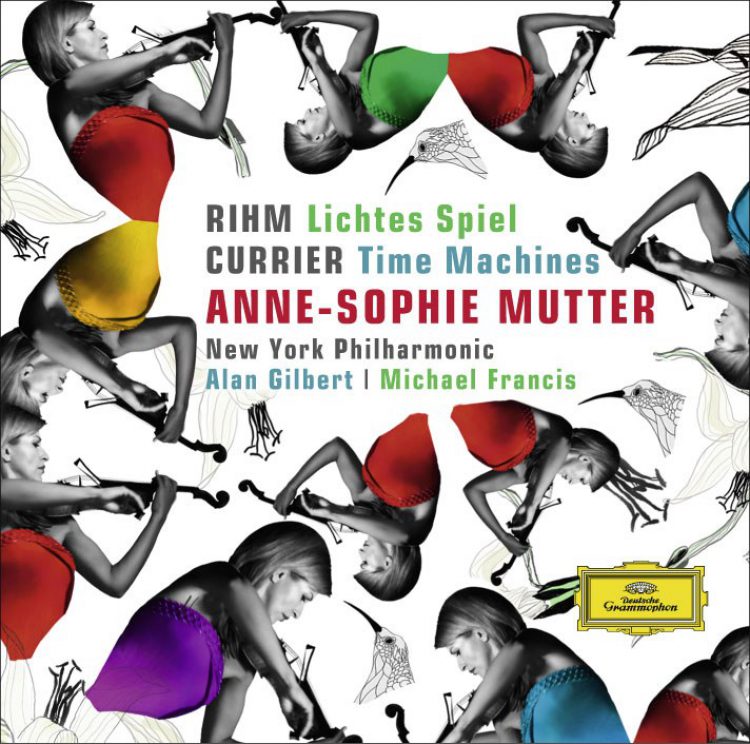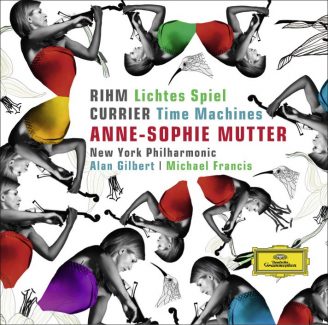Gerne kehrt sie dabei zu Künstlern zurück, die sie kennt. »Im Leben eines Solisten gibt es mehr als eine Facette. Nach einem Solokonzert wünsche ich mir meist ein Kammermusikwerk. Das war bei Krzysztof Pendereckis Metamorphosen so, es wäre auch bei Witold Lutosławski so gewesen, wäre er nicht verstorben.« Bei Wolfgang Rihm kam nach dem Violinkonzert Gesungene Zeit von 1991 zunächst ein weiteres Orchesterwerk dazwischen: Lichtes Spiel, 2010 in New York uraufgeführt. Doch die Kammermusik folgte in Form von Dyadeauf dem Fuß. Die Unterschiede zwischen den beiden Orchesterwerken liegen ohnehin auf der Hand.
Für Lichtes Spiel wünschte sich Anne-Sophie Mutter ein Mozart-Orchester. »Seit Jahren leite ich die Mozart-Konzerte von der Geige aus. Ich wollte diesen wunderbaren Werken einen Kontrapunkt entgegensetzen, in gleicher Orchestrierung, aber mit neuer Zeichengebung für die Geige.« Ihr Kalkül, die Beschränkung könne besonders inspirieren, ging auf. »Der Verzicht auf einen großen Schlagzeug-Apparat oder umfangreiches Blech führt zwangsläufig zur Konzentration auf das innerste Charakteristikum des Hauptinstruments, und das ist nun mal die Gesanglichkeit der Geige.« Die steht tatsächlich im Zentrum von Rihms Werk, das den Untertitel »Ein Sommerstück« trägt. Anne-Sophie Mutter assoziiert das »Lichte Spiel« einer Sommernacht, einen Sommernachtstraum, hört in den aufblitzenden Akzenten der Partitur Shakespeares Irrlichter. »Die flackernden Lichter erhellen immer wieder einen fast romantischen Schwebezustand. Vielleicht rührt daher der Gedanke des »Lichten Spiels«. Ich finde diese flirrenden Akzente typisch für Rihm, habe sie schon in Gesungene Zeit gefunden. Dieses Aufflackern einer Emotion, die Art, wie ein Intervall plötzlich in den Vordergrund tritt und sich dann wieder zurücknimmt, das ist charakteristisch für Rihms Diktion, auch in Dyade.«
Anders als in Lichtes Spiel, wo sich in den ersten Takten ein Thema manifestiert, wo es in fast klassisch angelegter Architektur Durchführung und Reprisen gibt, das Thema immer wieder präsent ist, bleibt die rhapsodische Dyade in unendlich fließender Bewegung. Die Partitur kennt keine Pausen. In einem Brief an Anne-Sophie Mutter bezeichnet Rihm Dyadeals eine »Zweierbeziehung mit allem Drum und Dran«. Das Werk verzichtet auf einen echten konzertanten Dialog, eher ließe sich von einer einzigen, dialogisch strukturierten Stimme reden. Die Musik hat etwas unmittelbar Greif- und Fassbares. Wenn Rihm von einem »Paarverhältnis« bzw. dem »Ergebnis einer Zusammenführung zweier Einheiten« spricht, dann ist das sofort nachvollziehbar: »Ernst und Süße sind unentwirrbar verwoben. Das Ganze ist ein in sich organisches, fließendes, wachsendes Gebilde, als sei es soeben improvisiert. Du kennst dieses Wachstumsdenken sicher aus den Werken von George Enescu. Organisches Wachstum, ganz aus der Linie geboren.«

So ist dieses intensive, lyrische Beziehungsgespräch, das zwei Personen mit einer Stimme führen, ein Mikrokosmos kleiner Gedanken und Ideen, kein musikalischer Dialog, in dem ein Thema exponiert und vom anderen Instrument aufgenommen würde. Diesen klassischen Ansatz hingegen verfolgt Krzysztof Pendereckis Duo concertante, in dem sich Violine und Kontrabass abwechseln, der eine schweigt, wenn der Partner einen klar umrissenen musikalischen Gedanken formuliert. »Wir spielen uns hier die Bälle zu oder gehen einander aus dem Weg. Zugleich verfügt das Stück über einen unerschöpflichen rhythmischen Muskel, nutzt die unglaubliche Gefährlichkeit der Attacke im Kontrabass. Ich bin froh, dass die beiden Werke die ganze Bandbreite im Zusammenspiel dieser extrem unterschiedlichen Streichinstrumente ausschöpfen: die symbiotische Verschmelzung und die klassische Duo-concertante-Form. In Auftrag gegeben haben wir sie wegen Roman Patkoló. Der Kontrabass wartet noch auf die Renaissance als Soloinstrument. Romans Persönlichkeit und seine schier unerschöpfliche Virtuosität geben jedem Komponisten Carte blanche.« Die nutzte vor allem Rihm: Dyade ist technisch waghalsig, mit irrwitzigen Sprüngen im Kontrabass, allerdings auch mit extrem anspruchsvollen Violinpassagen.
Schon in den 80er-Jahren widmete sich Anne-Sophie Mutter mit Clockworkeinem Werk von Sebastian Currier, das um die Zeit kreist. Die Geigerin lernte Currier über ihren langjährigen Kammermusikpartner Lambert Orkis kennen, und wenige Jahre später entstand das ihr gewidmete Kammermusikwerk Aftersong für Violine und Klavier, das Anne-Sophie Mutter Mitte der 90er-Jahre gemeinsam mit Lambert Orkis aus der Taufe hob. Und schon vor Time Machines hatte Currier ein Violinkonzert für sie komponiert, das wegen der extremen Orchesterbesetzung allerdings kaum realisierbar war. »Deshalb habe ich Sebastian um Umarbeitung gebeten. So entstand nach einem langen Schaffensprozess Time Machines, rhythmisch außergewöhnlich spannend, aber konventionell orchestriert und eigentlich ein Violinkonzert im klassischen Sinne. Musik ist ja gespielte Zeit, und so beschäftigt sich jeder der sieben Sätze mit der Zeit.« Tatsächlich schafft Currier ein Kaleidoskop unseres Erlebens von Zeit, zerlegt sie in Bruchstücke, verzögert, komprimiert, dehnt, zieht zusammen, lässt die Zeit mit Hilfe thematischer Vorwegnahmen vorwärts eilen, durch den Rückblick rückwärts laufen. »Alle Sätze zusammengenommen sind eine Art Zeitmaschine, die uns vorwärts katapultiert oder auch Rückschau halten lässt, überhaupt Zeit im Zeitraffer sichtbar macht.« Und ähnlich wie Lichtes Spiel verklingt Time Machines ganz leise, morendo. »Man schenkt mir einfach keine ›flashy endings‹, ich weiß nicht, weshalb. Aber ich bin dankbar für ein ehrliches Ende, das nicht auf einen leidenschaftlichen Begeisterungsausbruch des Publikums spekuliert, sondern einfach dem Innersten der Komposition entspricht.«
Oswald Beaujean
August 2011
Bitte akzeptieren Sie die entsprechenden Cookies, um den YouTube-Player anzuzeigen. Auf YouTube ansehen.
Bitte akzeptieren Sie die entsprechenden Cookies, um den YouTube-Player anzuzeigen. Auf YouTube ansehen.
Bitte akzeptieren Sie die entsprechenden Cookies, um den YouTube-Player anzuzeigen. Auf YouTube ansehen.